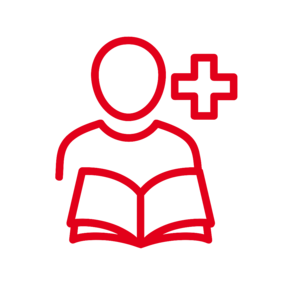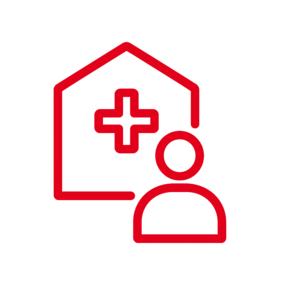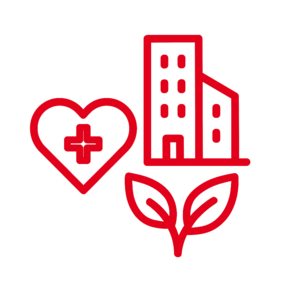Health Care Research & Community Health
Health Care Research & Community Health
Der Forschungsschwerpunkt umfasst die Gestaltung gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen sowie effizienter Gesundheitsversorgung von der Ebene der Patientinnen & Patienten bis zur Systemebene. Die individuelle Gesundheit, das Lebensumfeld und die Nachhaltigkeit der Strukturen stehen dabei im Fokus.
Dieser Forschungsschwerpunkt der Hochschule Bochum fokussiert auf die Gestaltung gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen sowie auf die Weiterentwicklung einer effizienten Gesundheitsversorgung, von der individuellen Ebene der Patientinnen und Patienten bis hin zu systemischen Strukturen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Professionalisierung der Gesundheitsberufe, die Qualität und Chancengerechtigkeit der Versorgung, die gesundheitsförderliche Gestaltung urbaner Lebensräume sowie Konzepte einer personenzentrierten Versorgung.
Die Forschenden verfolgen dabei einen inter- und transdisziplinären Ansatz, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Lösungsansätzen verbindet. Ein besonderes Anliegen ist es, evidenzbasierte und innovative Versorgungsmodelle zu entwickeln, gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren und die Gesundheit in unterschiedlichen Lebenswelten nachhaltig zu fördern, stets in Zusammenarbeit mit Partner*innen aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft.