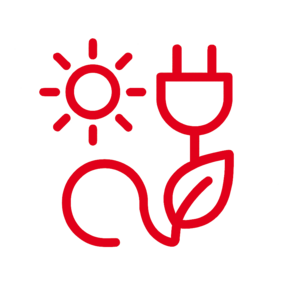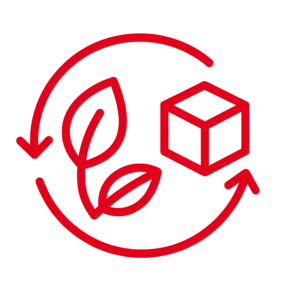Resources & Sustainability
Resources & Sustainability
In einem interdisziplinären Ansatz fokussiert dieser Forschungsschwerpunkt die Nachhaltigkeitswissenschaften sowie Ressourcennutzung und -management, wie Wasser und Energie. Er behandelt Versorgungssicherheit, Resilienz und zirkuläre Wertschöpfung für eine nachhaltige Zukunft.
Dieser Forschungsschwerpunkt der Hochschule Bochum fokussiert auf die nachhaltige Ressourcennutzung und das Ressourcenmanagement, insbesondere von Wasser und Energie, sowie auf die Nachhaltigkeitswissenschaften im Allgemeinen. Er behandelt unter anderem Themen wie nachhaltige Energielösungen, das ressourcenschonende Bauen, die Mobilitätswende, Versorgungssicherheit, Resilienz gegenüber Umweltveränderungen und zirkuläre Wertschöpfung für eine nachhaltige Zukunft.
In diesem Schwerpunkt verfolgen die Forschenden in erheblichem Maß einen inter- und transdisziplinären Ansatz mit dem Fokus auf nachhaltige Innovationen und Geschäftsmodelle für einen verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit Ressourcen. Ein besonderes Anliegen der Forschenden in diesem Forschungsschwerpunkt ist es, praktische Lösungen zu entwickeln und nachhaltige Transformationspfade aufzuzeigen sowie diese gemeinsam mit lokalen, regionalen und internationalen Partnern zu implementieren.