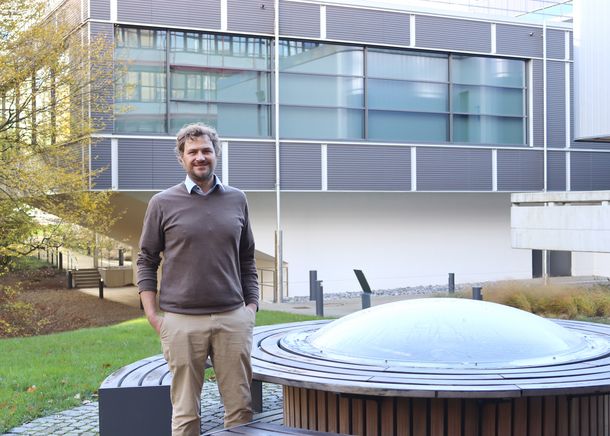Studium Geothermal Energy Systems: Wärme aus der Erde
06.11.2025 Magazin
Neuer englischsprachiger Masterstudiengang fokussiert Energiegewinnung aus geothermischen Quellen.
Sie arbeiten unterirdisch: Geothermische Technologien nutzen die natürlich vorkommende Wärme der Erde in unterschiedlichen Tiefen zum Heizen, Kühlen oder zur Erzeugung von Strom. Doch was geschieht eigentlich genau unter der Erde? Wie lässt sich aus geothermischen Quellen Energie gewinnen? Wie können Strömungen des Grundwassers für die effiziente Standortwahl einer Geothermie-Anlage simuliert werden und in welchen Ländern wird Geothermie heute in welcher Form genutzt? Das erlernen Studierende in drei Semestern im neuen englischsprachigen Masterstudiengang ‚Geothermal Energy Systems‘, der zum Sommersemester 2026 an der Hochschule Bochum startet.
Dr. Bastian Welsch, Professor für Geothermie und künftiger Studiengangsleiter, gibt Einblicke ins Studium.
Welches Potenzial zur nachhaltigen Energiegewinnung steckt in der Geothermie?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Je tiefer wir in die Erde vordringen, desto heißer wird es. Genau das macht sich die Geothermie zu nutze. Die oberflächennahe Geothermie nutzt die Wärme bis zu 400 Metern unter der Erdoberfläche um zum Beispiel mittels Wärmepumpen Ein- oder Mehrfamilienhäuser zu beheizten oder zu kühlen. Die Tiefengeothermie nutzt hingegen das tiefer in der Erde natürlich vorkommende heiße Grundwasser um mittels Geothermie-Kraftwerken Strom zu erzeugen oder Fernwärme zum Beispiel für ganze Stadtquartiere bereitzustellen. Wir gehen nun davon aus, dass die Erde in ihrem inneren Kern ungefähr 6.000 °C heiß ist. Je weiter wir uns von diesem Erdkern in Richtung Erdoberfläche bewegen, desto mehr nimmt die Temperatur ab, wobei rund 99 % der Erdmasse immer noch heißer als 1.000 °C sind und lediglich 0,1 % der Erdmasse Temperaturen unter 100 °C aufweisen. Mit dem gesamten Wärmeinhalt der Erde stünde uns so viel Energie zur Verfügung, dass damit der jährliche Energiebedarf der Menschen schätzungsweise für über 20 Milliarden Jahre gedeckt werden könnte. Die Geothermie ist aber nicht nur nahezu unerschöpflich. Erdwärme ist eine erneuerbare Energiequelle, die im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie wetterunabhängig zur Verfügung steht. Insofern ist die Geothermie eine spannende Energiequelle, die ein riesiges Potenzial birgt und in Zukunft eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Energieversorgung spielen wird.
Mit was für Fragen rund um die Geothermie beschäftigen sich die Studierenden in dem neuen Masterstudiengang?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Im Mittelpunkt des Studiengangs stehen die wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Nutzung von Erdwärme – von der Erschließung über die Energieumwandlung bis zur Systemintegration. Die Studierenden erwerben unter anderem Kompetenzen in der Analyse der geologischen Gegebenheiten eines Untergrunds: Welche physikalischen Eigenschaften zeichnen die jeweilige Gesteinsart aus? Wie ist ihre Wärmeleitfähigkeit oder ihre Wärmekapazität? Was kann über die Dichte des Gesteins und seine Porosität gesagt werden? Wieviel Energie könnte abhängig von den jeweiligen Untergrundverhältnissen aus welcher Tiefe gewonnen werden? Fragen, die den Standort einer Geothermie-Anlage bestimmen. Darüber hinaus beschäftigen sich die Studierenden mit Bohrverfahren zur geothermischen Energiegewinnung und dem Wärmetransport. Im Modul ‚Groundwater Hydraulics‘ analysieren sie unter anderem den Fluss des Grundwassers in Anhängigkeit von der Gesteinsart. Sie lernen die hydrogeologische Situation an einem Standort mathematisch zu beschreiben und die Strömungen des Wassers mittels Simulationen nachzubilden, um diese im Hinblick auf eine effiziente Standortwahl für eine geothermische Anlage zu bewerten und hinterfragen. Die Studierenden befassen sich mit der Konzeption von geothermischen Anlagen, nachhaltigem Ressourcenmanagement und der Energiepolitik. Im Modul ‚Large Scale Thermal Energy Storage Systems‘ widmen sie sich zudem der Frage, wie Wärme saisonal gespeichert werden kann, dafür setzen sie sich mit großen Wärmespeichersystemen auseinander. Die Studierenden lernen nachhaltige Lösungen für Speicherherausforderungen zu entwickeln und beziehen dabei die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Umweltauswirkungen von Speichersystemen mit ein. Ein spannendes Modul ist auch ‚Applied Geophysics‘.
Was lernen die Studierenden dort?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Dort lernen die Studierenden geophysikalische Messmethoden kennen um ein Abbild der Untergrundverhältnisse zu entwickeln. Eine dieser Methoden kann zum Beispiel Schallwellen im Untergrund erzeugen. An der Oberfläche messen wir in dem Moment mit speziellen Sensoren, wie schnell sich die Schwingungen ausbreiten und wann alle Schwingungen an der Oberfläche angekommen sind. Anhand dieser Messungen erhalten wir einen flächigen Blick in den Untergrund der Rückschlüsse ermöglicht, welche Schichten im Untergrund vorliegen. Die Studierenden lernen die Anwendungsbereiche verschiedener Messmethoden kennen, beschäftigen sich aber auch umfassend mit der Auswertung und Einordnung von Messdaten. Darüber hinaus binden wir die Geothermie global ein und schauen uns an, wozu sie in verschiedenen Ländern der Welt genutzt wird. In Ländern wie Island, Neuseeland oder Kenia, wo es viele vulkanische Regionen gibt, wird die Geothermie zu großen Teilen zur Stromerzeugung eingesetzt. In Deutschland steht die Wärmeerzeugung im Fokus.
Wie praxisnah ist das Studium?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Das Studium ist sehr praxis- und forschungsnah. Die Studierenden wenden ihr theoretisch erlerntes Wissen in den Hochschullaboren und im Gelände direkt an. In den Laboren nehmen sie zum Beispiel verschiedene Gesteine unter die Lupe, um ihre Eigenschaften festzuhalten. Die Studierenden führen aber auch Feldmessungen zur Erkundung des Erduntergrunds durch. Mit einer Tiefensonde lernen sie zum Beispiel Temperaturmessungen in Bohrlöchern vornehmen. Durch Forschungskooperationen, insbesondere mit dem benachbarten Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie, erwerben die Studierenden anwendungsorientierte Kompetenzen, die direkt auf die Anforderungen des globalen Energiemarktes zugeschnitten sind. In Gruppen werden die Studierenden an interdisziplinären Planungs- oder Forschungsprojekten mit Energie- und hohem Praxisbezug mitarbeiten und wissenschaftliche Lösungsansätze für Fragestellungen aus dem jeweiligen Projekt erarbeiten. In den Projekten geht es um aktuelle Entwicklungen, die die Branche prägen wie etwa die klimaneutrale Wärmeversorgung von Quartieren, also die kommunale Wärmeplanung. Dort geht es aber auch darum, dass die Studierenden Methoden des Projektmanagements anwenden, lernen sich in einem interdisziplinären Team zu organisieren und Projektergebnisse zu dokumentieren und präsentieren.
Was sollten Studieninteressierte mitbringen?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Das Studium richtet sich insbesondere an Studieninteressierte, die bereits einen ersten akademischen Grad erworben haben, zum Beispiel ein Bachelorstudium mit ingenieur- oder geowissenschaftlichem Hintergrund und einem energietechnischen Studienschwerpunkt. Die Studieninhalte des Masterstudiengangs werden bis auf zwei ergänzende Mathematikvorlesungen vollständig auf Englisch gelehrt, daher sollten für eine erfolgreiche Studienbewerbung hinreichende Englischkenntnisse nachgewiesen werden. Damit spricht der Studiengang aber nicht nur internationale Studienbewerber*innen an, sondern auch solche hierzulande, die vielleicht planen später im Ausland zu arbeiten und Lust auf ein Masterstudium in englischer Sprache haben. Das Masterstudium ist etwas für Studieninteressierte, die eine Affinität zu Naturwissenschaften haben, Neugier für technische Fragestellungen und wissenschaftliches Arbeiten mitbringen und eine internationale Karriere im Geothermie-Sektor anstreben.
Wie sind die Zukunftsaussichten für Absolvent*innen? In welchen Bereichen können sie nach dem Masterstudium tätig sein?
Prof. Dr. Bastian Welsch: Arbeitsplätze für Absolvent*innen finden sich in nationalen wie internationalen Energieunternehmen, in der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel bei Genehmigungsbehörden für Geothermie-Anlagen oder in Ingenieurbüros, die unterschiedliche Dienstleistungen anbieten, von der Planung und Machbarkeitsprüfung bis hin zu spezialisierten Bohrarbeiten und dem Bau von Geothermie-Anlagen. Darüber hinaus bereitet der Studiengang aber auch auf Tätigkeiten in Forschungseinrichtungen vor. Neben meiner Tätigkeit an der Hochschule bin ich im Beirat des Bundesverbands Geothermie, in dem neben Mitgliedern aus der Wissenschaft vor allem auch solche aus der Industrie, Planung und Energieversorgungsbranche vertreten sind. Alle berichten, dass die Nachfrage nach gut ausgebildete Expert*innen im Arbeitsfeld Geothermie wächst. Sowohl in der Forschung wie auch in der Anwendung werden Expert*innen gesucht, die ihre berufliche Zukunft darin sehen, die Nutzung geothermischer Quellen zur Energiegewinnung zu fördern.
Das Interview führte Daniela Schaefer, Online-Redakteurin
Studiengang Geothermal Energy Systems
Informationen zum Studiengang