Ressourcen und Nachhaltigkeit

Dieser Forschungsschwerpunkt der Hochschule Bochum fokussiert auf die nachhaltige Ressourcennutzung und das Ressourcenmanagement, insbesondere von Wasser und Energie, sowie auf die Nachhaltigkeitswissenschaften im Allgemeinen. Er behandelt unter anderem Themen wie Energiewende (vor allem nachhaltige Energielösungen), Versorgungssicherheit, Resilienz gegenüber Umweltveränderungen und zirkuläre Wertschöpfung für eine nachhaltige Zukunft.
In diesem Schwerpunkt verfolgen die Forschenden in erheblichem Maß einen inter- und transdisziplinären Ansatz mit dem Fokus auf nachhaltige Innovationen und Geschäftsmodelle für einen verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit Ressourcen. Ein besonderes Anliegen der Forschenden in diesem Forschungsschwerpunkt ist es, praktische Lösungen zu entwickeln und nachhaltige Transformationspfade aufzuzeigen sowie diese gemeinsam mit lokalen, regionalen und internationalen Partnern zu implementieren.
Laufende Projekte zu Ressourcen und Nachhaltigkeit

Projektleitung: Prof. Dr. Carla J. Vogt
Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit: 2025-2026
Im Projekt werden die Effekte heterogener Ungleichheitsaversion auf Pfade optimaler Klimapolitik in integrierten Bewertungsmodellen untersucht. Zentrale Fragestellung ist, wie sich die Ergebnisse bzgl. des optimalen Temperaturanstiegs gegenüber Standardpräferenzen ändern. Außerdem wird untersucht, wie heterogene Ungleichheitsaversion sich auf die Chancen internationaler Koalitionsbildung auswirkt.
Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke und Tobias Scholz, M.Sc.
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Projektträger: Bundesinstitut für Berufsbildung (bibb)
Förderprogramm: InnoVET
Laufzeit: 2024 - 2027
Herausforderung
Der Bedarf an Fachkräften im Handwerk und in der Industrie, die sich mit Batterietechnologien, Elektromobilität und Wasserstoffsystemen auskennen, steigt stetig. Um die Energie- und Mobilitätswende erfolgreich zu gestalten, müssen sich diese Fachkräfte weiterbilden, um innovative Technologien entwickeln und umsetzen zu können.
Lösung
Aufgabe des InnoVET Plus-Projekts TraFuSMS ist es, ein modulares Bildungskonzept zu entwickeln, das die bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung von Fachkräften für die Energie- und Mobilitätswende ermöglicht. Im Mittelpunkt stehen drei Module für Fachkräfte aus Kfz-Betrieben und der Industrie sowie Mitarbeitende von Start-ups und kleineren Betrieben im Bereich nachhaltiger Mobilität:
- Bewertung von Batterien in Elektrofahrzeugen: Dieses Modul befähigt Lernende und Unternehmen, Diagnose- und Instandsetzungsmaßnahmen an Elektrofahrzeugen und deren Energiespeichern durchzuführen.
- Innovationsmanagement in kleinen Unternehmen: Hier wird das unternehmerische und innovationsorientierte Verhalten der Mitarbeitenden innerhalb des Betriebes gefördert.
- Arbeiten an Wasserstoffsystemen und Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme: Lernende werden auf das sichere Arbeiten an Wasserstoffsystemen vorbereitet und erhalten das Wissen, um verschiedene Energiesysteme und Mobilitätslösungen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu bewerten.
Der modulare Aufbau der Qualifizierung ermöglicht auch Mitarbeitenden in Start-ups oder kleineren Betrieben die Teilnahme, ohne längere Abwesenheiten im Unternehmen zu verursachen.
Zudem wird die Nutzung intelligenter, KI-basierter Übersetzungssoftware erprobt, um die Inhalte durch englischsprachige Fachbegriffe zu erweitern und somit die Lernenden auf Dokumentationen in englischer Sprache vorzubereiten.
Transfer
Das Lernangebot soll nach erfolgreicher Erprobung durch die Handwerkskammer Dortmund (HWK), der Bochumer KFZ-Innung (KFZI) und der regionalen Industrie- und Handelskammer (IHK) zertifiziert werden. Diese Zertifizierung stärkt die Verstetigung und Anerkennung der Konzepte in der Branche.
Die entwickelten Lerninhalte sollen nach Projektende als Bildungsangebote oder zur Ergänzung der Ausbildung bei der Handwerkskammer und der Innung für Kfz-Gewerbe aufgenommen werden. Darüber hinaus bieten die technischen Lehrmodule direkte Anknüpfungspunkte zur Energiebranche, da Energiespeicher aus Kraftfahrzeugen als dezentrale Netzspeicher in Haushalten und der Industrie weiterverwendet werden.
Konsortium
- Hochschule Bochum
- Institut für Elektromobilität
- DigiTeach Institut
- Resort Studium, Lehre und Weiterbildung
- Handwerkskammer Dortmund
- KFZ-Innung Bochum
Assoziiert
- IHK Mittleres Ruhrgebiet
- Bochum Wirtschaftsförderung
- Weitere: Voltvogel, E-Adventures, ruhrvalley, Nüwiel


Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Inka Mueller
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Laufzeit: 2022-2024
Eine aktuelle Problematik der Schallemissionsprüfung ist die Vergleichbarkeit von Schallemissionssensoren unterschiedlicher Hersteller und die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sensorik im Labor- und Feldeinsatz.
Im Rahmen des Vorhabens sollen zwei Bereiche adressiert werden. Im Bereich der Sensorkalibrierung sollen Vergleiche der verschiedenen favorisierten Verfahren durchgeführt werden. Hierzu sollen Untersuchungen zur Kalibrierung mittels eines Laservibrometers als Referenzmesssystem durchgeführt werden und Untersuchungen mittels direkt angekoppelter Sensoren. Auf Basis dieser Untersuchungen soll eine Spezifikation/Norm vorbereitet werden, die aufzeigt, wie Schallemissionssensoren praktikabel vergleichbar kalibriert und charakterisiert werden können.
Für den Bereich der Sensorverifizierung liegt der Fokus in der Identifikation einer praktikablen Vorgehensweise zur einfachen Nutzung im Labor und im Feld. Der Schwerpunkt liegt auf der Bestimmung der wesentlichen Einflussgrößen auf das Prüfergebnis und die Gestaltung eines Verfahrensprotokolls zur Prüfung der Funktionalität in einem wellenbasierten Ansatz oder in einem Ansatz unter Nutzung der elektromechanischen Impedanz. Dies soll ebenfalls als Grundlage für die Erarbeitung einer Spezifikation/Norm dienen. Der Fokus der Arbeiten der BO liegen im Bereich Sensorverifizierung mittel elektromechanischer Impedanz.
Mit den Erkenntnissen aus dem Projekt soll die Marktdurchdringung der Schallemissionsprüfung durch die Entwicklung von einheitlichen Schnittstellen, Merkblättern, Spezifikationen und Normen unterstützt werden. Gleichsam sollen damit Wege aufgezeigt werden, wie die prekäre Situation der Sensorkalibrierung auf internationaler Ebene überwunden werden kann.


Projektleitung: Prof. Dr. Haydar Mecit
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Laufzeit: 2022-2025
Die Energiewende ist für uns nicht nur aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage, Energieressourcenknappheit und Energiepreisexplosion von Belang. Ein Wandel hin zu nachhaltigen Energiequellen ist vor allem auch angesichts des Klimawandels eine zentrale Aufgabe unserer Generation für die Sicherheit und Zukunft nachfolgender Generationen.
Dieses Spannungsfeld wird an der Hochschule Bochum insbesondere durch die Entwicklung sowie auch Erprobung neuartiger, digitaler Energie-Lösungen für urbane Räume vorangetrieben. Im Rahmen des BMWK-Projektes SEGuRo werden wir gemeinsam mit der RWTH Aachen und dem lokalen Energieversorger Stadtwerke Herne AG entsprechende F&E-Arbeiten zur sicheren Digitalisierung eines Stromnetzabschnittes im realen Stadtumfeld umsetzen. Die Entwicklung hin zu einem sog. Smart Grid geschieht dabei gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang wird auch von sog. Smart-Energy-Lösungen gesprochen, wobei ein besonderer Fokus auf das Themengebiet der sicheren, kritischen Energie-Infrastrukturen gelegt wird.
Die zunehmende Durchdringung von verteilten Erzeugern (z.B. Photovoltaik-Anlagen) und Lasten (z.B. Elektroautos und Wärmepumpen) auf Verteilnetzebene führt zu einem dynamischeren und zunehmend unvorhersehbaren Netzverhalten. Dies erfordert eine flexible Regelung der Anlagen in Verteilnetzen, um diese möglichst in Einklang mit den Lasten zu bringen, damit weiterhin Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu gewährleisten sowie kritische Netzzustände zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wird im Rahmen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes der Redispatch 2.0 eingeführt, welcher die Verschiebung der Stromproduktion auch für kleinere Anlagen ab 100kW vorsieht. Eine dementsprechende Regelung erfordert innovative Lösungen zur Verteilnetzüberwachung, welche ein ganzheitliches Systemverständnis ermöglicht und in diesem Projekt entwickelt werden soll.
Das SEGuRo Konzept sieht eine fälschungssichere Signierung von Messdaten direkt am Messpunkt, einen sicheren Kommunikationskanal zur Übertragung der Daten und eine echtzeitfähige Monitoring Plattform vor. Die Monitoring Plattform umfasst im Wesentlichen eine Kombination aus digitalem Zwilling und dynamischer Netzzustandsschätzung sowie Datenmanagement und Visualisierung. Eine solch vollumfängliche Kombination von Technologien ist eine Innovation in der Netzüberwachung und bietet eine elementare digitale Grundlage, nicht nur zur Netzregelung, sondern auch für die flexible Abrechnung von u.a. neuartigen Netzdienstleistungen.
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Hense und Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz
Fördermittelgeber: Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, Land NRW
Laufzeit: 2023-2024
Mit dem Projekt EcoTecHub Bergkamen entsteht im Kreis Unna ein Innovations- und Technologiezentrum („Hub“) für nachhaltige Wertschöpfung. Hier begleitet das EcoTecHub künftig Unternehmen bei der Gestaltung nachhaltiger Transformationsprozesse vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der ehemaligen Steinkohlekraftwerksregion Bergkamen. Das Projektvorhaben befasst sich primär mit Innovationen im Bereich Kreislaufwirtschaft und Defossilisierung, der thematische Schwerpunkt liegt in den Bereichen Energie und Materialien.
Mit der Entstehung des EcoTecHubs leistet das Projekt einen aktiven Beitrag an der Transformationsgestaltung der ehemaligen Kohleregion Kreis Unna hin zu einer innovativen und zukunftsgerichteten Region. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Bochum und Gelsenkirchen schafft das Projekt in der Region einen dauerhaften Know-How-Transfer mit der Angewandten Forschung (der Kreis Unna verfügt selbst über keinen öffentlichen Universitäts- oder Hochschulstandort). Der EcoTecHub verknüpft Entwicklungs-, Produktions-, Recycling- und Digitalisierungskompetenzen und bietet auf diese Art ein in der Region einzigartiges Angebot für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Defossilisierung. Das EcoTecHub befasst sich u. a. mit den Kreislaufperspektiven von Wasserstofflösungen für die Industrie, oder forscht an der Optimierung des (chemischen) Recyclings von Kunststoffprodukten und -teilkomponenten.
Dem Projekt EcoTecHub ist eine 14-monatige Vorstudie im Zeitraum Oktober 2023 – Dezember 2024 vorgestellt. In dieser Laufzeit untersuchen Forschungsteams der Hochschule Bochum und der Westfälischen Hochschule, inwieweit der EcoTecHub mit den Schwerpunkten Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in der Region verankert werden kann, damit sich die Stadt Bergkamen für eine Förderung durch das 5-StandorteProgramm qualifizieren kann. Im Rahmen des Projektes werden unter anderem Analysen zur Identifikation von Bedarfen, Anforderungen und Potenziale von Unternehmen in der Region durchgeführt. Ein Ziel ist dabei die Untersuchung von standortspezifischen und strukturrelevanten Aspekten unter Einbindung von Ideen und Vorstellungen der heimischen Wirtschaft für den Aufbau und dauerhaften Betrieb des Technologiehubs. Die Forschenden erarbeiten überregionale, langfristige und strategische Projektinhalte, die durch ansässige Unternehmen aktuell noch nicht adressiert werden, aber großes (Innovations-)Potenzial für die Region und darüber hinaus zeigen. So werden Entwicklungs- und Umsetzungsszenarien sowie ein Finanzierungs- und Betreibermodelle entwickelt, welche die Zukunftsfähigkeit der Akteure, Produkte und Prozesse des Standortes Bergkamen durch den Aufbau eines regionalen Technologie- und Wissenstransferhubs optimieren.
Projektleitung:Prof. Dr.-Ing. Andreas Dridiger und Alexander Kremer M.Sc.
Laufzeit: 06.2024 - 05.2026
Kooperationspartner: AVG Mineralische Baustoffe GmbH / GNF Berlin-Adlershof e.V. / Hochschule Bochum
Fördermittelgeber: BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM))
Der Estrich ist ein kritisches Gewerk im Bauablauf. Während seiner Erhärtung und Trocknung können kaum andere Gewerke fertiggestellt werden. Bodenbeläge dürfen erst verlegt werden, wenn der Restfeuchtegehalt im Estrich nicht wesentlich vom späteren Feuchtegehalt während der Nutzungszeit abweicht. Die Trocknung dieser überschüssigen Feuchtigkeit ist ein komplexer Vorgang, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Das Nichterreichen der Belegreife zum geplanten Zeitpunkt führt vor allem in den Sommermonaten häufig zu Verzögerungen im Bauablauf.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Fließestrichmörtels auf Basis von Calciumsulfoaluminatzement unter Verwendung von aufbereiteten hydraulisch wirksamen RC-Gesteinskörnung und Portlandzement, der die Belegreife wesentlich schneller erreicht als alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Produkte, gleichzeitig jedoch die hohen derzeitigen Anforderungen an Estrichmörtel vollends erfüllt. Dabei wird angestrebt den Anteil des Portlandzementes gering zu halten oder ganz durch das RC-Material zu ersetzen, wodurch der CO2-Fußabdruck des Fließestrichmörtels verbessert werden soll.

Projektleitung: Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries
Laufzeit: 10/2020 – 09/2024
Koop-Partner: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), Landesverband Berlin (Konsortialleitung)
Im Mittelpunkt des Moduls MonDoWi an der Hochschule Bochum steht die Förderung von Kooperationen im Energiesektor. Zentrale Aspekte sind
- Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis: Es bringt Forschungsteams mit Handwerkern, Unternehmen und Politikern zusammen, um die Energiewende zu unterstützen.
- Förderung des gesellschaftlichen Wandels: Das Modul erleichtert Diskussionen und Kooperationen für größere Veränderungen im Energiesektor.
- Kommunikationsbarrieren überwinden: Angesichts der Herausforderungen in der Kommunikation werden Experten einbezogen, um effektive Kommunikationsräume zu schaffen, sowohl physisch als auch virtuell.
- Globaler und praktischer Fokus: In Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung liegt der Fokus auf globaler Zusammenarbeit und praktischen Anwendungen im Bereich der energetischen Nachhaltigkeit.
- Ziele: Ziel ist es, eine effektive Zusammenarbeit zu erreichen, gemeinsame Visionen zu entwickeln, erfolgreiche Zusammenarbeit zu demonstrieren und Netzwerkveranstaltungen zu organisieren.
Weiter Informationen zu diesem Projekt finden Sie hier.

Projektleiter: Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries
Förderprogramm: Innovative Hochschule
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Laufzeit: 01/2023 – 12/2027
Insektenfreundliche Pflanzen, Beete mit Grünkohl und Kartoffeln, ein erholsamer Barfußpfad: Der Hochschulgarten BOase am Campus Bochum macht bereits vor, wie Nachhaltigkeit und Gärtnerei lebendig werden und wie eine engere Verbindung zur eigenen Ernährung und Natur aussehen kann. Nun sollen in der Metropole Ruhr weitere nachhaltige Ökosysteme geschaffen werden, die permakulturell ausgerichtet – also natürlichen Abläufen nachempfunden – sind. Immer im Blick dabei: Städtische Grünflächen werden nicht nur als ökologische Flächen verstanden, sondern als Orte der Gemeinschaftsbildung, die zum Mitmachen anregen sollen. Wie gelingt das? Erlebnisorientierte Ansätze aus der Nachhaltigkeitswissenschaft liefern neue Antworten.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Christoph Mudersbach in Kooperation mit Prof. Dr Jörg Frochte
Sachschäden in Milliardenhöhe, fast 200 Tote: Das Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 hat gezeigt, dass die Metropole Ruhr nicht ausreichend auf Wetterextreme in Folge des Klimawandels vorbereitet ist. Dabei kann Künstliche Intelligenz helfen, die Widerstandsfähigkeit der Städte zu verbessern. Im Projekt entsteht ein digitales und smartes Überwachungssystem für überflutete Straßen. Wo wird es in der Metropole Ruhr besonders gefährlich, wenn es zu Hochwasser kommt? Die Analyse von Wetterdaten und Vorhersagemodelle sollen Hinweise liefern. Das Forschungsgebiet Wasserbau und Hydromechanik arbeitet zusammen mit Expert:innen für angewandte Künstliche Intelligenz an der zentralen Frage: Wie sieht eine Stadtentwicklung aus, die Fluten, Starkregen und Co. mitdenkt? Gemeinsam mit z. B. Wasserverbände, Kommunen, Stadtbetriebe und -verwaltungen werden Lösungen erarbeitet und umgesetzt.


Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch & Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Laufzeit: 2023 – 2027
Wer bekommt wie viel Platz? Bei der Frage nach der Aufteilung der städtischen Verkehrsflächen hat das Auto in den Ruhrgebietsstädten klar die Nase vorn. Damit Radfahren und Zufußgehen attraktiver und sicherer werden, muss sich das ändern. Zu neuen Nutzungsmöglichkeiten zählen neben Radwegen beispielsweise Stadtmöbel und Flächen für Kinderspiel. Sind die Menschen bereit dazu? Und welche Auswirkungen hat es, wenn die Straßenfläche neu verteilt wird? In konkreten städtischen Gebieten soll das analysiert und erprobt werden. Dabei kommt z. B. eine Zukunftswerkstatt mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden sowie Online-Befragungen zum Einsatz. Den Tiefbau- und Planungsämtern von Kommunen in der Metropole Ruhr werden am Ende des Projekts Konzepte für Verkehrsexperimente überreicht.
Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Inka Mueller
Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit: 2020 – 2025
Unter Structural Health Monitoring (SHM) werden kontinuierliche oder periodische und automatisierte Methoden zur Bestimmung und Überwachung des Zustandes eines Überwachungsobjektes innerhalb der Zustandsüberwachung verstanden. Diese erfolgt durch Messungen mit permanent installierten bzw. integrierten Aufnehmern und durch Analyse der Messdaten.
Um Structural Health Monitoring Systeme ganzheitlich bewerten und für gesellschaftlich relevante Projekte wie zivile Infrastruktur einsetzen zu können, fehlen derzeit Methoden zur Gütebestimmung dieser Systeme, die über einen Test am spezifischen Anwendungsbeispiel hinausgehen. Insbesondere für den Bereich des SHM basierend auf geführten Wellen gibt es bislang keine etablierte Vorgehensweise zur Qualifizierung der Systeme, sodass dies den Fokus des beantragten wissenschaftlichen Netzwerks bildet.
Wellenbasierte, aktive SHM-Systeme sind thematisch mit klassischen Ultraschallverfahren verknüpft. Für diese Verfahren liegen Methoden zur Gütebestimmung vor. Jedoch gibt es eine Reihe von Unterschieden. Entscheidend ist beispielsweise, dass SHM-Systeme feste Sensorpositionen aufweisen, die eine Ortsabhängigkeit des Ergebnisses zur Schadensdetektion nach sich ziehen. Zudem ermöglichen viele wellenbasierte SHM-Systeme die Ausgabe einer Reihe von schadensrelevanten Parametern wie Schadensort, Schadensgröße etc. Hier scheint die Reduktion der Daten auf einen festen Wert des Schadensindikators, wie es für das klassische Verfahren zur Gütebestimmung in der zerstörungsfreien Prüfung notwendig ist, nicht sinnvoll. Diese Unterschiede als Mehrwert auch in der Gütebestimmung nutzbar zu machen, ist aus Sicht der Mitglieder zwingend erforderlich.
Ziel des wissenschaftlichen Netzwerks ist es daher, durch themenbezogenen Austausch ein gemeinsames Verständnis für die aktuellen Probleme in der ganzheitlichen Gütebestimmung von wellenbasierten SHM-Systemen zu entwickeln, gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren, diese zu publizieren und als Grundlage für mögliche zu beantragenden Forschungsprojekte auszuarbeiten.


Projektleitung: Prof. Dr. Stephan Sommer
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Laufzeit: 2022 – 2025
Kooperationspartner: UFZ Leipzig
Für das langfristige Gelingen der Energiewende ist es entscheidend, dass diese gerecht gestaltet wird. Bei der Standortwahl für Infrastruktur zur erneuerbaren Stromerzeugung und -verbreitung spielen Gerechtigkeitsaspekte besonders durch die räumliche Varianz damit verbundener lokaler Kosten (z. B. Lärmemissionen) und Nutzen (z. B. regionale Wertschöpfung) eine wichtige Rolle. Diese räumliche Ungleichverteilung lokaler Effekte kann zum Widerstand gegen Energieinfrastrukturprojekte beitragen.
In diesem Zusammenhang behandelt das Vorhaben die Frage, wie Verteilungsgerechtigkeit zwischen Regionen auch bei der Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energieinfrastruktur mitgedacht werden kann und sollte. Dazu wird erarbeitet, wie interregionale Verteilungsgerechtigkeit auf den räumlichen Ausbau von Energieinfrastruktur angewendet werden kann, zu welchen Verteilungs- und Effizienzwirkungen sie in der Praxis führt und wie sie regulatorisch umsetzbar ist.
Das Vorhaben umfasst dazu die konzeptionelle Aufarbeitung verschiedener Gerechtigkeitsansätze sowie deren empirische Anwendung auf den Ausbau erneuerbarer Energieinfrastruktur in Deutschland. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partner:innen aus der Praxis werden die Projektergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz für und Anwendbarkeit auf die Praxis kritisch analysiert. Der Einbezug von Bürger:innen im Rahmen einer Befragung ermöglicht außerdem die Berücksichtigung der öffentlichen Präferenzen zu verschiedenen Gerechtigkeitskonzepten. Die abschließend erfolgende rechtliche und ökonomische Instrumentenanalyse zur Umsetzung verschiedener Gerechtigkeitskonzepte beim Ausbau von Energieinfrastruktur stellt damit eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheider:innen dar.
Weitere Informationen zu diesem Projekt hier.
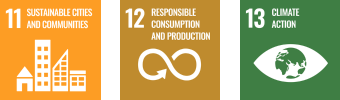
Projektleitung: Prof. Dr. Stephan Sommer
Fördermittelgeber:Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
Laufzeit: 2023 – 2024
Die drei Ruhrgebietshochschulen für angewandte Wissenschaften, die Hochschule Bochum, die Fachhochschule Dortmund und die Westfälische Hochschule bündeln ihre Kompetenzen, um in dem gemeinsamen Forschungs- und Transferprojekt „Nachhaltige IGA 2027“ ein integratives Nachhaltigkeitskonzept für Großveranstaltungen zu entwickeln. Die Internationale Gartenschau (IGA) in der Metropolregion Ruhr im Jahr 2027 dient dabei als Reallabor. Sie verfolgen das Ziel, das Thema Nachhaltigkeit in besonderer Durchdringung und Tiefe bei der Planung, Durchführung und Nachnutzung von Großveranstaltungen zu verankern. Integrativ ist das Konzept, weil das Mitdenken der Nachhaltigkeitsaspekte und die Handlungsempfehlungen von Anfang an direkt in den unterschiedlichen Prozessen innerhalb der verschiedenen zeitlichen Phasen (z.B. bei den Ausschreibungen) ansetzen und es die folgenden drei Aspekte miteinander verbindet: (1) Nutzung der Umweltentlastungspotenziale, (2) Gestaltung der Gartenschau als Lernort für Nachhaltigkeit, (3) frühzeitige Einbindung direkt beteiligter Institutionen sowie weiterer, indirekt beteiligter Stakeholder (z.B. Stadtgesellschaften) zur Integration der Gartenschau selbst und ihrer Intention in die Sozialstrukturen vor Ort. Insgesamt soll das Nachhaltigkeitskonzept sechs Handlungsfelder umfassen: Ressourcen & Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft & Nachnutzung, Nachhaltige Mobilität, Nachhaltige Beschaffung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Kommunikation & Partizipation.
Projektleitung: Prof Dr Mi-Yong Becker
Mit dem Projekt THALESruhr verwirklicht die Hochschule Bochum die Vision der „Grünsten Industrieregion Europas“. Neun einzelne Transferprojekte entwickeln Lösungen auf den Gebieten „Resilienz, Mobilität, Energie“, „Nachhaltiges Leben und Wirtschaften“ und „Produzieren, Planen, Bauen“.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz
Geldgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
Volumen (in €): 907.022,01
Laufzeit: 01/2023 – 12/2025
Kooperationspartner: Green Power Brains, SFC Energy und Don Bosco Solar
In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, darunter auch Ghana, stehen die nationalen Stromnetze vor Herausforderungen, die zu einem unzuverlässigen Zugang zu Elektrizität führen. Trotz der Entwicklung Ghanas werden im Jahr 2020 nur 86% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität haben. In ländlichen Gebieten liegt die Elektrifizierungsrate mit 28,5 Prozent noch niedriger. Die Auswirkungen des Klimawandels wie Dürren und niedrige Wasserstände des Akosombo-Staudamms belasten die Stromversorgung zusätzlich, die häufig durch fossile Brennstoffe ersetzt wird, was den CO2-Ausstoß erhöht.
Das Projekt GH2GH geht diese Probleme an, indem es sich auf grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme konzentriert. In einem Pilotprojekt in Tema, Ghana, werden ein Elektrolyseur und ein Speichersystem in ein bestehendes Mini-Solarnetz integriert. Dieser grüne Wasserstoff versorgt eine Brennstoffzelle in Zeiten ohne Sonneneinstrahlung, fördert die Energieautarkie und verringert die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren.
Das Projekt wird den Lebenszyklus, die soziale Akzeptanz und die Nachhaltigkeit des Systems im Vergleich zu Batterien bewerten. Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes ist es, ein umfassendes Netzwerk aufzubauen, rechtliche und administrative Hürden abzubauen und die Technologie für eine breitere Anwendung zu exportieren.

Projektleitung: Prof. Dr. Oliver Stengel & Prof. Dr. Jacinta Kellermann
Die Umwelt dankt, wenn ein Fahrrad repariert, statt ersetzt oder die Bohrmaschine ausgeliehen statt neu gekauft wird. Die Hochschule Bochum ist bei sogenannten Repair- und Sharing-Konzepten schon jetzt Vorreiterin: z. B. mit einem Repaircafé und der Bibliothek der Dinge, in der über 1.000 Gebrauchsgegenstände ausgeliehen werden können. Noch mehr Menschen in der Metropole Ruhr sollen davon profitieren und gleichzeitig Müll reduzieren. Deshalb wollen die Fachbereiche Wirtschaft, Elektrotechnik und Informatik Leih- und Repairstationen in der gesamten Metropolregion vernetzen – digital und Vor-Ort. Neue Werkstätten sollen in Kombination mit Bibliotheken der Dinge entstehen, ebenso ein Fernleihnetz, über das sich die einzelnen Zentren austauschen können.

Projektleitung: Prof. Dr. Marcus Schröter
Wenn Güter und Waren produziert werden, entstehen Treibhausgasemissionen – auch in der Metropolregion Ruhr. Vollständig klimaneutrale Wertschöpfungsketten sind die Ausnahme. Wie lassen sich solche Emissionen kompensieren? Die Bereiche Nachhaltigkeit im Ingenieurswesen und nachhaltige Entwicklung wollen eine innovative Technik einsetzen: Treibhausgas lässt sich durch Verschwelung in Pflanzenkohle binden. Sie kann anschließend beispielsweise die Fruchtbarkeit von Böden in der Landwirtschaft erhöhen oder in der Betonproduktion als Ersatz für Sand genutzt werden. Im Projekt werden eigens Pyrolyseofen gebaut, Anlagen in Betrieb genommen und Versuche zur Bodenwirkung der Pflanzenkohle durchgeführt. Kleine und mittlere Unternehmen aus der Region sollen in Workshops über solche Formen der Klimakompensationen aufgeklärt werden. Wenn sie ihre eigenen CO2-Emissionen kompensieren möchten, unterstützt die Hochschule Bochum sie bei der Suche nach privaten Dienstleistern.
Projektleitung: Prof. Dr. Erik H. Sänger
Förderer: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderzeitraum: 2019 – 2022 (verlängert)
Experimente haben die Sensitivität von Ultraschallwellen für verschiedene Belastungen von Stahlbeton belegt. Analysewerkzeug ist hierbei die Coda-Wellen-Interferometrie (CWI). Beton ist jedoch ein stark heterogenes und dicht gepacktes Verbundmaterial. Aufgrund der hohen Anzahl von streuenden Bestandteilen und Lufteinschlüssen setzt sich die Ausbreitung von Ultraschallwellen in diesem Material aus einer komplexen Mischung von Mehrfachstreuung, Modenkonversion und diffusen Energietransport zusammen. Zum besseren Verständnis des Einflusses von Aggregaten, Porosität und Rissverteilung auf die Ausbreitung elastischer Wellen im Beton und zur Optimierung von Inversionstechniken ist es sinnvoll, den Wellenausbreitungs- und Streuprozess explizit im Zeitbereich zu simulieren. Wir verwenden zu diesem Zweck die “rotated staggered grid” (RSG) Finite-Differenzen-Technik zum Lösen der Wellengleichungen für elastische, anisotrope und / oder viskoelastische Medien.
Das Projekt ist in drei Arbeitspakete unterteilt. Der erste Teil konzentriert sich auf Simulationen im Probenmaßstab (nm - cm - Bereich). In enger Zusammenarbeit mit RUB1, TUM1 und BAM werden wir den Einfluss verschiedener Belastungen (z. B. Druck, Temperatur oder Feuchtigkeit) auf die Coda-Wellen untersuchen. Die von RUB1 entwickelten mikrostrukturellen Modelle und mikro-omographischen Bilder von Beton dienen als Input für Vorwärtssimulationen. Diese werden mit den Laborexperimenten von TUM1verglichen und gemeinsam interpretiert.
Im zweiten Arbeitspaket werden wir Simulationen im Bauteilemaßstab (cm – m – Bereich) durchführen. Ziel ist die numerische Unterstützung von Experimenten der Teilprojekte TUM1, RUB2 und BAM bezüglich der Wellenausbreitung. Ebenso werden die jeweiligen numerischen Verfahren von RUB1 und TUM2 ergänzt. Der Hauptunterschied zum ersten Teilprojekt besteht darin, dass wir jetzt strukturelle Grenzen und großräumige Heterogenitäten einbeziehen. Darüber hinaus bestimmen wir die optimale Platzierung der Ultraschallsensoren.
Das dritte Arbeitspaket zielt darauf ab, die klassische CWI-Technik für Stahlbetonbauteile mit drei Inversionstechniken zu ergänzen, die der Antragsteller bereits auf andere Fälle angewendet hat. Wir werden spezifische Attribute entwickeln, die empfindlich auf die unterschiedlichen Belastungen reagieren. Ein Beamforming-Algorithmus wird uns helfen, die Richtungs- und die Frequenzabhängigkeit der Codawellen zu verstehen. Mit Time-Reverse-Imaging (TRI) können wir Zonen mit relativ hoher Streuung oder andere sekundäre Quellen lokalisieren. Zusammenfassend werden wir CWI mit Hilfe von leistungsfähigen Computersimulationen und der Anwendung von geophysikalischen Inversionstechniken optimieren. Die qualitative und quantitative Langzeitbewertung von Stahlbetonbauteilen wird weiterentwickelt.

Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke, Prof. Dr. Roland Böttcher & Dr.-Ing. Alexandra Lindner
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Laufzeit: 2023 – 2027
Das Projekt StartUpLabs@BO begann Anfang 2023 an der Hochschule Bochum und wird vom Bundesministerium für Forschung und Bildung im Programm "Forschung an Fachhochschulen" unterstützt. Es dauert vier Jahre und konzentriert sich darauf, die Gründungsaktivitäten an der Hochschule zu verbessern. Dabei soll das StartUpLab erste Anlaufstelle und offener Treffpunkt für Gründungsinteressierte sein und den kreativen Akteur:innen besondere Freiräume für das Experimentieren, Validieren und Testen von innovativen Ideen bieten. Dafür wird die entsprechende Ausstattung bereitgestellt und die Studierenden, Mitarbeitenden sowie Lehrenden unterstützt.
Die vier wesentlichen Ziele des Projekts sind:
Steigerung der Transfer- und Gründungsbefähigung an der Hochschule Bochum.
Aufbau und Vernetzung dezentraler Labs und eines zentralen StartUpLabs.
Erhöhung der Diversität in Gründungen.
Entwicklung von Angeboten für Alumnae* und Alumni*.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Projekts.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert & Clara Walsemann, M.Sc.
Laufzeit: 2023 – 2025
Fördermittelgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Der Baustoff (Stahl)beton dominiert nach wie vor die weltweite und deutsche Baubranche. Bei der Herstellung von einer Tonne des für Beton benötigten Zementes werden 0,61 t CO2 freigesetzt. Allein im Hochbau werden weltweit etwa 2,5 Mrd. Tonnen Zement verbraucht. Davon entfallen allein 55 % und somit ca. 1,4 Mrd. Tonnen Zement und 0,83 Mrd. Tonnen CO2 auf Decken und Fundamente im Hochbau.
Eine Lösung zur Reduktion des Betoneinsatzes in Decken und Fundamenten bieten Hohlkörper mit einem Einsparpotenzial an Material und CO2 von bisher ca. 25 % gegenüber massiven Betondecken. Nachteil bisheriger Hohlkörper-Systeme ist jedoch die deutliche Reduktion der Querkrafttragfähigkeit gegenüber Betonmassivdecken, sodass sich der effektive Einsatzbereich auf ca. 60 % der Decken- bzw. der Fundamentfläche verringert. Dadurch weist die Leichtbauweise mit Hohlkörpern bisher häufig Kostennachteile gegenüber massiven Decken/Fundamenten auf. Trotz der Umweltvorteile von Hohlkörpersystemen wird daher weiterhin der weitaus größte Teil der Decken und Fundamente in massiver Bauweise ausgeführt.
ZentralesZiel des Projektes ist es, die Querkrafttragfähigkeit von zweiachsig gespannten Hohlkörperdecken und -fundamenten um 50 % zu steigern und auf diese Weise das Einsatzgebiet der Hohlkörpertechnologie sowie das Einsparpotenzial hinsichtlich Material und CO2 zu maximieren. Dieses Ziel soll erreicht werden durch ein neues geometrisches Prinzip der Hohlkörpertechnologie. Es handelt sich um kegelstumpfförmige Hohlkörper, die mit der „spitzen“ Seite alternierend nach oben und nach unten eingebaut werden und so exakt den Kraftfluss in Decken/Fundamenten abbilden. Durch die erhöhte Querkrafttragfähigkeit der neuen Hohlkörper-Technologie wird der Einsatz auch in Bereichen nahe von Wänden und Stützen ermöglicht. Dadurch erhöht sich der Einsatzbereich auf bis zu 80 % der gesamten Decken-/Fundamentfläche. Über diesen Ansatz werden bis zu 40 % des eingesetzten Betons in Decken und Fundamenten eingespart. Zudem sollen sie erstmals auch klare Kostenvorteile gegenüber Massivdecken aufweisen, so dass sie flächendeckend in die Anwendung überführt werden können und eine schnelle, akute und hohe Umweltwirkung erzielen.

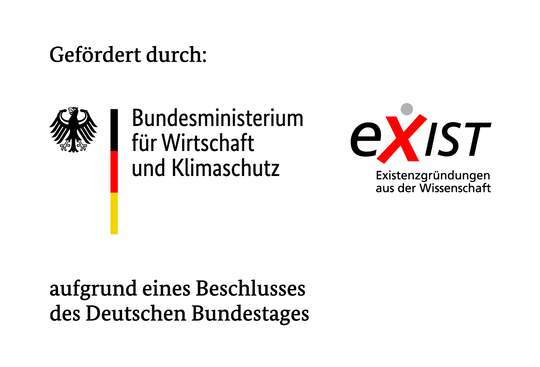
Projektleiter: Dr. Alexandra Lindner
Laufzeit: 12/2023 – 11/2024
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Die Start-up-Strategie der Bundesregierung zielt darauf ab, die Start-up-Szene durch die Stärkung von Gründerinnen und die Förderung von Diversität zu stärken. Die Gründerinnenquote in Deutschland verzeichnet mit 20 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt eine erhöhte und in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz. Dies ist teilweise auf das Engagement von Gründungsnetzwerken zurückzuführen, die vielfältige Angebote zur Sensibilisierung, Förderung und Vernetzung von Frauen in der Gründerszene bereitstellen.
Mit der Einführung von EXIST-Women erhalten gründungsinteressierte und gründungsaffine Frauen an Hochschulen die Gelegenheit, sich frühzeitig mit den Themen Gründung und berufliche Selbständigkeit vertraut zu machen. Ziel ist es, das Engagement der Gründungsnetzwerke an Hochschulen zu verstärken, um Frauen verschiedener Hintergründe für das Thema Gründung zu motivieren. Dazu zählen Absolventinnen, Wissenschaftlerinnen, Studentinnen sowie Frauen mit Berufsabschluss und Bezug zur Hochschule, wie beispielsweise Technische Assistentinnen, Chemisch-technische Assistentinnen und Verwaltungsfachangestellte.
EXIST-Women umfasst verschiedene Fördermöglichkeiten:
- Veranstaltungsangebote: Es werden Veranstaltungen organisiert, die darauf abzielen, Frauen für das Thema Gründung zu sensibilisieren und sie mit relevanten Ressourcen und Netzwerken vertraut zu machen. Alle 14 Tage finden Vorträge und Workshops zu Themen rund um den Unternehmensaufbau, Persönlichkeitsbildung sowie Netzwerkveranstaltungen statt.
- Beratungs- und Betreuungsangebote: Es werden Beratungs- und Betreuungsdienste angeboten, um angehenden Gründerinnen bei der Entwicklung ihrer Geschäftsideen und der Umsetzung ihrer Gründungsprojekte zu unterstützen. Für die Durchführung von Veranstaltungen sowie spezialisierten Beratungsangeboten stehen der Hochschule 10.000 Euro Budget zur Verfügung.
- Finanzielle Zuschüsse: Angehende Gründerinnen erhalten finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 2.500 Euro sowie Sachmittel im Wert von 2.000 Euro, um ihre Gründungsvorhaben voranzutreiben und die ersten Schritte in die Selbständigkeit zu erleichtern. Aktuell befinden sich 10 angehende Gründerinnen in der Fördermaßnahme mit Gründungsideen, die von sehr frühphasig bis kurz vor der Gewerbeanmeldung variieren.
Weitere Infos zum Projekt here.








